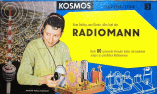der Elektromotor ist die Krönung der Experimente aus dem Elektromann, handwerklich mit Abstand das Anspruchsvollste daraus.
Die Anleitung bietet zuvor eine Reihe von einfacheren Experimenten, mit denen in mehreren Schritten die Funktionsweise des Motors erklärt wird.
Leider ist sie auch für die Verhältnisse der 70er Jahre etwas altbacken und legt den Schwerpunkt auf die technische Anwendung der beobachteten Phänomene, die für sich systematisch kaum erläutert werden.
Der Motor-Versuch hat sicherlich für zahlreiche Enttäuschungen und Wutanfälle in den Kinderzimmern gesorgt. Er hat drei entscheidende Knackpunkte, nämlich
- das Wickeln der drei Spulen des 3-T-Ankers,
- der Aufbau der Kollektorlamellen bis zum Anschluss an die Spulen,
- die Herrichtung der Schleifkontakte.
Alles andere ist übliches Schrauben und Klempnern wie in den anderen Versuchen - zwar aufwändig, aber die dafür nötige Erfahrung kann in diesem Stadium vorausgesetzt werden.
Ebenfalls problematisch ist der hohe Materialverbrauch in diesem Versuch. Mit Verbrauch meine ich nicht die Zahl der benötigten Teile, sondern nur die Teile, die dabei irreversibel verformt werden und daher bei einer kompletten Demontage und einem erneuten Aufbau nicht wieder genutzt werden können.
Schaltungsdraht und Kupferlackdraht sind nicht das Problem, denn das ist billig in jedem Fachgeschäft nachzukaufen.
Die Messingteile aber, die einen beträchtlichen Teil der Ausstattung darstellen, können nicht mehr in den Ursprungszustand versetzt werden.
In den letzten Tagen konnte ich das Experiment mit den meisten Originalteilen nachbauen. Ziel dabei war die Vermeidung von Materialverbrauch. Alles sollte hinterher wieder rückgebaut und neu benutzt werden können.
Erstes Opfer ist der Ausschneidebogen. Daraus müssen drei Papierteile ausgeschnitten werden, die das Anker-Eisen vor dem Kontakt mit dem Wicklungsdraht schützen. Auch seinerzeit konnte jeder Anwender entscheiden, ob er den Bogen verbraucht oder eine Kopie macht bzw. die einfachen Figuren abpaust. Der musste also nicht zwangsläufig verbraucht werden. Ich habe einen ausgedruckten Scan verwendet.
Die Wicklung der Spulen ist ausreichend erklärt, aber im Alter der Zielgruppe hätte ich mir bessere Erläuterungen zu den Einzelheiten gewünscht, auf die es ankommt und die leicht vergessen werden. Da wäre z.B. die Vorbereitung der Anschlüsse. Wenn man vergisst, die ca. 10 cm Draht zwischen den Spulen für die Anschlüsse vorzusehen, muss man alles wieder abwickeln. Es gibt in dem Abschnitt Fehlerquellen, die schwer korrigierbar sind:

Ist die Spule fertig, muss der Kollektor montiert werden.
Dieser Teil des Versuchs ist in Konzeption und Material misslungen.
Den Kollektor zusammenzusetzen und mit der Spule zu verbinden, ist filigranes Kunsthandwerk, aber machbar.
So soll es dann aussehen:

Die Kollektorlamellen werden unwiderruflich verbogen. Man kann sie bei einem Rückbau in diesem Zustand aufbewahren und wieder einsetzen, aber ein Fehler ist dann schlecht korrigierbar.
Schwerer wiegt der Schwindel mit dem Bild: In der unteren Skizze sieht man die Kanten der Kollektorbleche, wenn man genau auf die Drehachse blickt. Das sieht schön kreisrund aus, mit den drei Unterbrechungen bei den Zwischenräumen.
In der Realität ist es leider anders. Der Krümmungsradius der Bleche ist zu groß! Er entspricht genau dem Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Lochscheibe und dem äußeren Rand der äußeren Löcher, also ca. 1 mm zu viel. Die Folge ist eine Deformation dieses dreiteiligen Kreises und die Oberfläche des Kollektors hat nicht überall den gleichen Abstand zur Drehachse. Daher werden die Schleifkontakte beim Betrieb des Motors unweigerlich heftig gerüttelt. Der Motor läuft nicht so ruhig wie er soll.
Ich habe mit zu wenig und lausigem Werkzeug diesem Übel abzuhelfen versucht - prinzipiell erfolgreich, aber mit den Mängeln eines Hauruck-Experiments:

Im Keller habe ich noch einen hölzernen Rundstab gefunden, davon ein Stück abgesägt, in der Mitte durchbohrt und drei kleine Messingbleche aus einem Streifen geschnitten, an einem Ende mit einem Lock für die Drahtanschlüsse und der nötigen Krümmung versehen und mit Zweikomponentenkleber auf den Holzzylinder geklebt. Nach dem Aushärten schnitt ich die überstehenden Bleche zu und bog die schmalen Enden um. Fertig montiert sieht der Kollektor so aus:

Er hat leider noch zwei Fehler: Der Messingstreifen war zu schmal, die Abstände sind so groß, dass der Stromfluss im Betrieb unterbricht: Der Motor rappelt etwas und muss meistens erst einmal angestupst werden, dann dreht er sich aber mit beachtlicher Geschwindigkeit von selbst.
Und die Bohrung ist mir nicht genau mittig gelungen - das Ding hat eine kleine Unwucht. Ich verspreche, beides zu verbessern.
Nun kann man entscheiden, ob man einem verbesserten Elektromann diesen Kollektor gleich als Baugruppe mitgibt oder entsprechende Bleche und Zylinder plus doppelseitiges Klebeband getrennt.
Aus einem Teil des Messingstreifens bastelte ich Halterungen für die Schleifkontakte. Die Montage gemäß der Anleitung kam nämlich nicht in Frage, denn da steckt ein weiterer konzeptioneller Fehler. Diese hauchdünnen Bleche muss man brutal verbiegen, eines sogar regelrecht falten. Dadurch wird das Material geschädigt und falls ein zweiter Versuch nötig ist, bricht es unweigerlich. Stellt man sich vor, dass ein z.B. Zehnjähriger auf Anhieb dieses Messing-Origami hinbekommen soll, muss man über die Anleitung hier den Kopf schütteln.


Hier eine schnell am Sonntagnachmittag zusammengeklempnerte Alternative:

Den linken Anschluss musste ich unter der Platte anklemmen, weil oben kein Platz mehr war.
Durch die Mängel des Kollektors geraten diese Messinghalterungen in federnde Schwingungen, was dem Betrieb des Motors aber nicht schadet. Er läuft nun weniger ruhig. Um das zu verbessern, setzte ich zwei Schrauben ein (M3 x 30), die die Bleche halten. Auf diese Weise wird die Zerstörung der Schleifbleche vermieden und die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs erhöht, ohne dass der Aufwand größer wird: Man muss dem Kasten nur zwei handelsübliche Schrauben beilegen und spart sogar einen Haltewinkel.
Zum Aufbau gehört auch ein Polwender, der so wie in der Anleitung beschrieben, fehleranfällig ist. Dazu später mehr. Die nötigen Änderungen lassen sich leicht mit der vorhandenen Ausstattung umsetzen. Hier noch ein Bild dazu mit den beiden Tasten links:

Als nächstes plane ich den Aufbau eines anderen Kollektors, der kostengünstig, nutzerfreundlich und in allen Teilen experimentierkastengerecht wiederverwendbar sein soll. Mehr dazu später hier.
Grüße
Walther