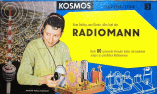Hochspannungsversuche mit Christbaumschmuck
Weihnachten (I)
Hallo Liste,
Kürzlich hatte ich die Anregung gepostet, sich mit Weihnachtsbaum-Schmuck für elektrostatische Versuche auszustatten, genauer für die erweiterte Ausstattung des eigenen Aufbaus mit Kugelkondensatoren und Kugelfunkentrecken und weiteren Einsatzteilen.
Einkauf
Heute kaufte ich in einem Kaufhaus Christbaumschmuck unter elektrostatischen Gesichtspunkten ein ...
* eine Perlenkette mit glänzenden Perlen aufgereiht auf einer silbrig glänzenden, 5 Meter langen "Kordel"
* ein gewundenes Gewürm, mit silbrig glänzender Oberfläche
* eine transparente Plastikkugel (eine Hälfte klar, die andere Helfte rot, gefüllt mit Styropor-Kügelchen)
* ein 6er-Satz mit Kugeln mit metallischer Oberfläche (3 glänzend, 3 matt)
Kugel und Gewürm hängen an üblichen Hängern, die sich im Innern aufspreizen und so das Objekt locker halten und über den oberen Bogen im Halter aufgehängt werden können.
Große Enttäuschung
Die Überprüfung mit dem Ohmmeter zuhause ergibt ...
keine Leitfähigkeit messbar außer den Perlen (4 Ohm) auf der Kordel und der silbrigen Kordel, mit dem das Preisschild mit Bar-Code angebunden ist.
Somit hatte ich mich massiv getäuscht. Aber es gibt ja die Plastikkugel mit Innenleben, da wird mir schon etwas einfallen.
Stresstest
Und mit dem unnützen Schrott, den ich nicht brauche, den werde ich einem "Stresstest" ohne jegliche Rücksichtnahme unterziehen.
Stresstest - silbrige Kordel
Der Aufbau ist wie üblich: vom 18-kV-Ausgang des PHYWE 2...18 kV Netzteils führt ein Kabel zum ersten Kugelkondensator, zwischen ihm und dem zweiten Kugelkondensator ist der 2-Gigaohm-Widerstand eingehängt. Von dort geht es weiter zum Elektrometer, an dessen Anschluss auch als erstes Opfer die abgeschnittene silbrige Kordel von einem Preisschild angeklemmt wurde.
Berühre die silbrige Kordel mit dem Erdkabel von unten. Ab ca. 5 kV fängt sie bereits ohne Annäherung des Erdkabels an zu zittern und bewegt (beugt) sich auf den Bananenstecker am Ende dieses Kabels zu, es folgen Überschläge mit Lichtbögen, die Berührung Kordel mit Bananenstecker und sofort darauf die Abstossung der silbrigen Kordel. Und es geht weiter, immer im Wechsel bleibend. Bereits mit einer einfachen leitfähigen Kordel lässt sich also elektrisches Ping-Pong spielen.
Neuer Galgen
Für (genauere) Ping-Pong-Pendelversuche habe ich mir einen Galgen gebaut: zwei Tonnenfüsse, zwei senkrechte PVC-Rohre, oben quer ein U-Profil aus PVC aufgesetzt mit mehreren 4-mm-Bohrungen, durch die Kordeln, Drähte und Drahtkonstruktionen hindurch passen, um an ihnen verschiedene Objekte aufzuhängen.
Stresstest - Das Gewürm
Dieses Teil sieht schon deutlich technischer aus, wie die Blitzröhre eines Rubinlasers. Ich bleibe bei der Bezeichnung "Das Gewürm" und hänge dieses am neu gebauten Galgen auf (Befestiung für Xmas-Baum oben, stumpfe Spitzes des "Gewürms" nach unten zeigend.
Bereits unterhalb von 5 kV geht ein leichtes Zittern durch den Wurm. Und er lenkt an seiner Spitze ein wenig aus. Bei inzwischen 18 kV dauert es lange, bis die anfänglichen Schwingungen zur Ruhe kommen.
Jetzt nehme ich den schwarzen Stecker am Ende vom Erdkabel und nähere mich der Spitze an. Ab 10 mm Zirpen, dann ab ca. 6 mm kräftige (laute und helle) Überschläge in die stumpfe Wurmspitze.
Überschläge in die Oberfläche des gewundenen Teils sind noch viel spektakulärer: Kaum setzt bei ca. 12 mm das Zirpen ein, bruzzelt es auch schon laut, und kurz danach treten kurze, laute, helle, periodische Überschläge (mit Strukturen im Lichtbogen) über einen Schlagweite von 12 mm auf.
Sehr eindrucksvoll und Interessant, dass bei großen Radien viel mehr passiert, als an der unteren stumpfen Spitze. Bei großen Radien tritt Koronaentladung eben viel später auf, an Spitzen (bei kleinen Radien). Die hat bereits lange zuvor begonnen.
Nun gehe ich ins andere Extrem und wähle als Erdelektrode die spitze Spitze einer Funkenstrecke. Bereits mehr als 40 mm setzt das Zirpen der Koronaentladung ein und bewirkt einen Spannungsabfall am Elektrometer. Ab 12 mm stellen sich Lichtbögen ein, wenn sich die spitze Spitze genau unterhalb der stumpfen Spitze vom "Gewürm" befindet.
Je größer die Radien der beiden sich gegenüber stehenden Elektroden, um so mehr rutschen die Orte (Grenzradien) der verschiedenen Effekte (bei Annäherung von außen) zusammen, sodass es schwierig wird, eine Koronaentladung zu beobachten, ohne dass bereits gleichzeitig die unmittelbare Vorstufe eine Überschlags mit Lichtbogen beginnt.
Die Spitze wird jetzt entlang des oberen, gewundenen Teils des "Gewürms" geführt. Aber das ist kaum spektakulärer. Durch lokale Koronaentladung (Spitzenentladung) geht zu viel der gespeicherten Ladung verloren, bervor es zu Überschlägen kommt. Bei einem stumpfen Bananenstecker ist die Spitzenentladung viel geringer, darum knallt es, wenn es denn knallt, viel knalliger.
Erdungskugel
Daraus ergibt sich: nicht nur mit der Spitzen-Elektrode Überschläge erzeugen, auch mit ebener Platte, bzw. mit einer Kugelelektrode mittleren bis größeren Durchmessers. Es gibt Tabellen, wo aus Abstand und Kugelradius die Überschlagsspannung abgeleitet werden kann (Ersatz fürs Messen).
Und daher setzte ich den Versuch fort mit Überschlägen zur geerdeten Kugelelektrode mit Durchmesser von 6 cm (genauer: 56 mm). Ich lasse die Funken (Lichtbögen) zwischen der Kugel und dem stumpfesten Teil des "Gewürms" überspringen
Es stellt sich dabei die Vermutung ein, es erfolgten Durchschläge aus dem Inneren der gewundenen Röhre heraus auf ihre Aussenseite, also durchs Glas bzw. durch Trägermaterial nach außen, da die Aussenfläche sich ja als nicht leitend erwiesen hatte.
Ab 10 mm lassen sich jetzt kräftige Überschläge zwischen Erdungskugel (geerderter Kugelelektrode) und der unteren stumpfen Spitze des "Gewürms" beobachten.
Ich führe die Erdungskugel nun entlang der Seiten des "Probanden" nach oben: kräftige, helle und laute Überschläge ab 8 mm. Das "Gewürm" lenkt dabei start seitlich aus, wird von der Erdungskugel angezogen, beide bilden zusammen bilden ja einen Kondensator (wenn auch etwas exotischen). Dadurch dürfte die Kapazität zugenommen haben und mehr Ladung für den Lichtbogen zur Verfügung stehen (?).
Sonnenbrille
Seit einem Tag verfüge ich über eine Sonnenbriller mit Gläsern, welche vollständig UV-Strahlung (UV A, UV B) und zu 85% Blau unterdrücken. Ist das auch zweifelsfrei gesund für meine Augen, einige der Experimente haben ja Einfluss auf Umwelt und Gesundheit, so bin ich nach der Durchführung der Experimente mit der Neuen enttäuscht:
Sahen die Funken und Lichtbögen immer schön hell, weiß und blau aus, so sind sie nun mit der Sonnenbrille schwach und gelblich. Also setze ich die Brille doch wieder (gelegentlich) ab ... Eigentlich müsste ich auch mein Gesicht und die Hände mit [b]Schutzfaktor 20x einschmieren[/b], habe auf einmal das Gefühl von gespannter Haut, auch die Nase hat sich gerötet, aber ich mag nicht mit pappigen Händen schreiben und experimentieren
Bei der Gelegenheit darf ich daran erinnern, dass moderen Lehrmittel verbunden sind mit der Warunung, bei Glimmentladungen (manchmal auch Hochvakuumröhren) nicht über 5 kV hinaus zu gehen. Bei solchen Spannungen kann bzw. entsteht Röntgenstrahlungen.
Wir erzeugen ja (demnächst wohl) mit Influenzmaschine und Bandgenerator Spannungen, die von 100 kV bis 250 kV (oder mehr) gehen. Auf youTube gibt es auch Marx-Generatoren bis 1 MV. Das sollte man im Auge behalten. Hier wäre imo auch externer Sachverstand aus dem Kreis der "verantwortlichen Experimentatoren" bzw. Lehrer sinnvoll ... Wer also Pädagogen der Physik kennt, könnte die ja bitte mal anzapfen, wie wir uns als Experimentatoren schützen können und sollten.
Aus den USA wurden in Blitzlabors in der freien Natur (induzierte natürlich Blitze, Rakete die dünnen Draht hinter sich her zieht und die in Gewitterwolken geschossen werden, bei den erhofften Blitzeinschlägen nicht nur Röntgenstrahlung sondern sogar Gammastrahlung entsteht. War mal im Fernsehen.
Ich spiele noch ein paar Runden elektrisches Ping-Pong. Dann ist der Versuch mit diesem Objekt beendet.
Untersuchung mit Lupe und Fingernagel
Im Hellen am nächsten Tag stelle ich fest, dass sich auf der Oberfläche des "Gewürms" kleine Löcher befinden, also hat das Experiment gestern bleibende Spuren auf dem Teil hinterlassen. Auch eine größere dunkle Fläche fällt auf. Das schaue ich mir genauer an, mit Lupe, Fingernagel und ...
Die kleinen "Löcher" erweisen sich als irregular, als ob hier kleine Stückchen aus der Oberfläche abgeplatz wären. Mit dem bei allen von uns hochsensiblen Fingernagel, mich "gruselts" und schüttelt bei der Vorstellung, diesen senkrecht über eine raue Oberfläche zu ziehen. Diese Sensibilität wird in einigen Unternehmen durch Vergleich zwischen genormten und produzierten Oberflächen zur Qualitätssicherung benutzt. Auf der Oberfläche des "Gewürms" fahnde ich aber auch feinsten Abstufungen, die mir der Lupeneindruck nahelegt. Und finde diesen bestätigt. Also ist hier etwas auf der Außenfläche passiert, der Stress ist real, nicht virtuell eingebildet.
An die Stelle mit dem dunklen Fleck (Dm. ca. 8 mm) hatte ich gestern längere Zeit die Erdungskugel gehalten. Und der "dunkle Fleck" ist kein solcher sondern ein Fenster, durch das ich ins Innere des Teils hineinschaue. Die "Metallisierung" lässt kein Licht durch, daher rührt die Dunkelheit.
Unter der Lupe sehe ich zudem konzentrische Wälle (wie in der Wallebene Orientalis auf dem Mond). Handelt es sich hier um Aufschmelzungen? Kleinere Details erinnern an winzige Bläschen. Und im extremen Gegenlicht erkenne ich kurze Schlagschatten, wo die senkrechten Wände dieser "Wälle" in die horizontale Oberfläche übergehen.
Durch dieses intensive Hin- und Her hat sich oben die eingeklebte Halterung gelöst, und ich halte das "Gewürm" erstmals wieder in der eigenen Hand. Wo der außere kronenartige Rand der Halterung die Oberfläche berührt, zeigen sich auch "Löcher" bzw. "Abplatzungen". Da ist offenbar auch ein (erster) Lichtbogen übergegangen, denn die Halterung war mit +18 kV verbunden. Beim führen einer Messspitze über die vermeintliche Stufe empfinde ich in den Fingern, welche die Messspitze halten, eine kurze äußerst subtile Empfindung. Die "Abplatzungen" sind also wirklich real.
Untersuchung mit dem Ohmmeter
Mit dem Ohmmeter versuche ich die Leitfähigkeit innen im "Gewürm" zu messen, aber messe ich selbst im höchsten Widerstandsbereichs keine Leitfähigkeit. Daraus folgt, die leitfähige Schicht muss sich irgendwie irgendwo "aussen" befinden.
Aufbau (Vermutung)
Alle Fakten zusammen ergeben folgendes Bild: das Xmas-Baum-Gehänge entstand in einer Glasbläserei (wie normale Weichnachtsbaumkugeln auch). Es wurde metallisiert mit einem chemischen Verfahren (hatten wir im Chemieunterricht mal gemacht, so werden auch Spiegel hergestellt). Und zum Schutz vor Verschmutzung wurde die Außenseite mit einem Schutzlack überzogen.
Wikipedia
Auf Wikipedia lesen wir bei Weichnachtsbaumschmuck bein den Kugeln, dass die Verspiegelung ab 1870 mit Silbernitrat erfolgt, das auch bei der Herstellung von Spiegeln eingesetzt wird. Justus von Liebig gelang damals, "Glaskörper mit einer Silberlösung zu beschichten und zum Glänzen zu bringen". Es handelt sich um das in Wasser leicht lösbare Silbernitrat. Bei "Erhitzen auf etwa 440 °C erfolgt Zersetzung unter Abscheidung von metallischem Silber und Abgabe nitroser Gase."
OK, damit alles klar.
Entstehung von Abplatzungen und Wallebene
An der Halterung oben entsteht ein erster Überschlag / Durchschlag durch die Schutzschicht zur Silberschicht. Diese leitete den Strom bis zu den Stellen, wo außen die Elektroden (geerdete Bananenstecker, Spitzen, Erdungskugel) sich nähern. Dort erfolgt von der Silberschicht ein Durchschlag durch den Schutzlack hindurch und dann der Überschlag (ein Durchschlag durch Dielektrikum "Luft") in die geerdete Elektrode.
Die sehr dünne Silberschicht ist diesem Stress nicht gewachsen und platzt ab (und trägt Huckepack auch Teile der Schutzlackierung von dannen). Die thermische Belastung durch permanente Überschläge zur Erdungskugel führt im Bereich des Fensters (dem großen "dunklen Loch") nicht nur zum Abplatzen, sondern weiter nach außen, wo die Silberschicht intakt bleibt, zum Aufschmelzen der Schutzlackschicht. Thermisch bedinkte Luftströmungen oder auch elektrostatische bzw. -dynamische Kräfte (der Elektronenwind ?) blasen bzw. schieben die verflüssigte Lackschicht in Wellen nach außen, wo sie erkaltet und wieder erstarrt.
Die Leitfähigkeit müsste doch zu messen sein !
Wenn es diese Abstufungen gibt, wo die Silberschicht abgeplatz ist, müsste man doch die Stirnfläche der Silberschicht, ihre Querschnittsfläche anzapfen und zwischen zwei Stellen die Leitfähigkeit messen können. Der Leiter ist doch Silber ! Allerdings, die Stufen müssen kleiner, müssen viel dünner sein als 0,1 mm.
Ich kratze, schiebe und drücke, aber das Ohmmeter im DMM mit digitaler Anzeige zeigt keinen Mucks, es ist dafür ungeeignet. Geht das also nicht? Ich mache jetzt schon so lange mit dem "Gewürm" herum, dass ich mich noch nicht von diesem trennen kann. Vielleicht gelingt es ja nicht, den zeitweise immer erzielten Kontakt, gleichzeitig an zwei Stellen so lange gleichzeitig bestehen zu lassen, dass das DMM seinen Messalgorithmus durchnudeln kann.
Da kommt mir ein Idee: Die Messspitzen sind das Problem. In der Medizin werden am menschlichen Objekt doch gelegentlich feuchte Elektroden befestigt, das mache ich jetzt auch.
"Flüssige" Messspitzen
Ich nehme einen Becher, streue 1/8 Teelöffel Salz (NaCl) hinein, Wasser dazu und zweimal umgerührt, nicht schütteln. Dann lege ich zwei Streifen Küchenkrepp hinein. Die heraus gefischten mit Sole getränkten Papierstreifen sind meine flüssigen Messspitzen.
Eine solche Feucht-Elektrode lege ich auf die untere stumpfe tlw. abgeplatzte Spitze, die andere kommt auf das "Fenster". Alle Abplatzungen, Löcher und das Fenster sind nun bestens als dunkle Stellen unter dem feuchten Krepppapier zu erkennen (Totalreflexion !). Beide Kontakstellen liegen auf trockener Unterlage aus Keramik. Die Oberfläche des Gewürms ist peinlichst genau getrocknet worden. Ich drücke die festen Messspitzen gegen ihre flüssigen Teammitglieder vorsichtig so ein, dass meine Finger(spitzen) weder mit den Kontaktstellen noch anderen Bereichen des Probanden in Berührung kommen, manchmal muss man auch im 9-Volt-Bereich vorsichtig sein
Und starre gespannt auf die Digitalanzeige des Ohmmeters. Diese zeigt wie bisher das Symbol für Unendlich. Da! Auf einmal bewegt sich was, Ziffern, Zahlen tauchen auf: ... 18 MOhm, 17 MOhm, schließlich 15 Megaohm. Hurra, voller Erfolg. Mir geht es richtig gut. Hat ja auch lange genug gedauert.
Investiton in Weihnachtsbaumkugeln
Aus der Geometrie (Abstand der Messstellen, Umfang des "Gewürms"), dem spezifischen Widerstand von Silber (Ag) und dem gemessenen Widerstand könnte man (aber nicht heute Nacht) die Dicke der Silberschicht bestimmen. Und das könnte ja wichtig werden ...
Vielleicht muss jemand mal einen Silber-Widerstand für 15 MOhm zusammenbauen oder bei den niedrigen Zinsen in Weihnachtsbaumkugeln investieren ...
Gruss
Hans-Günter